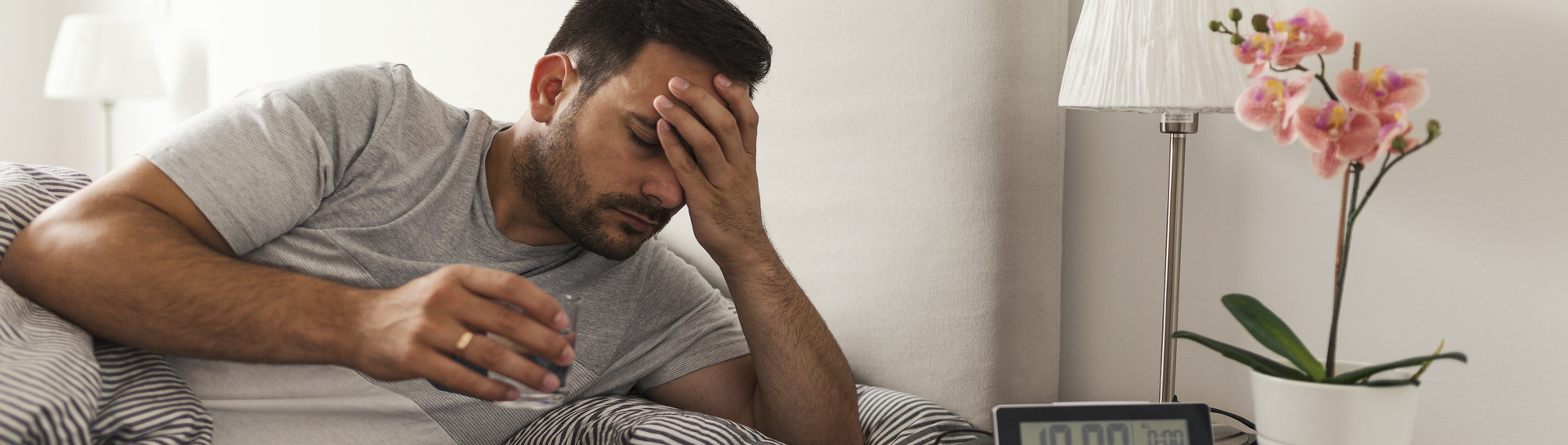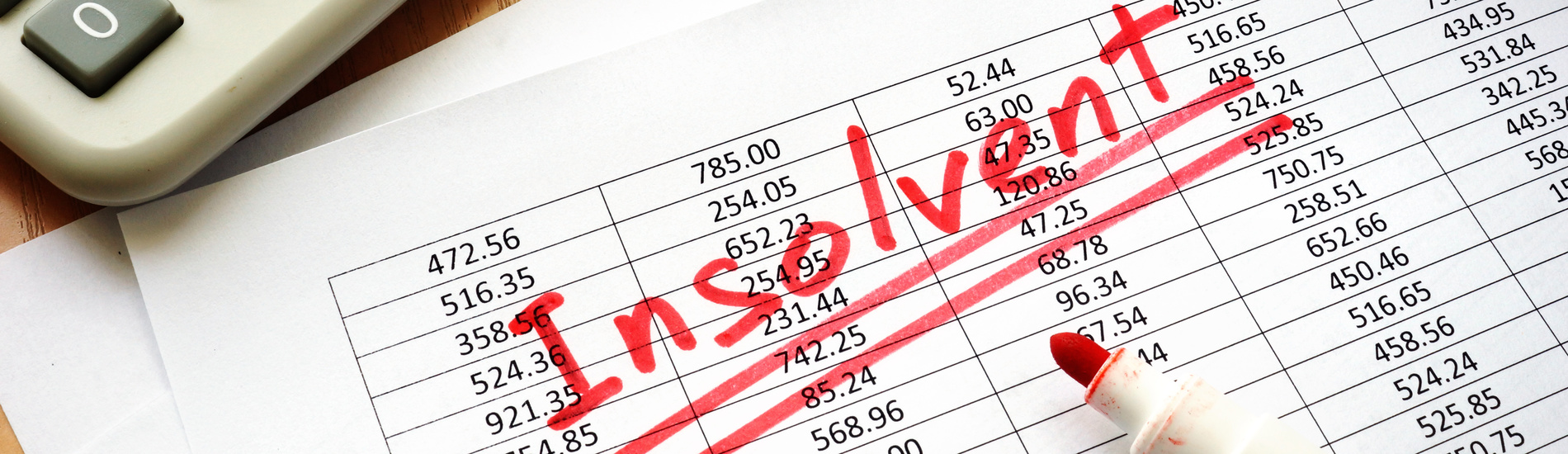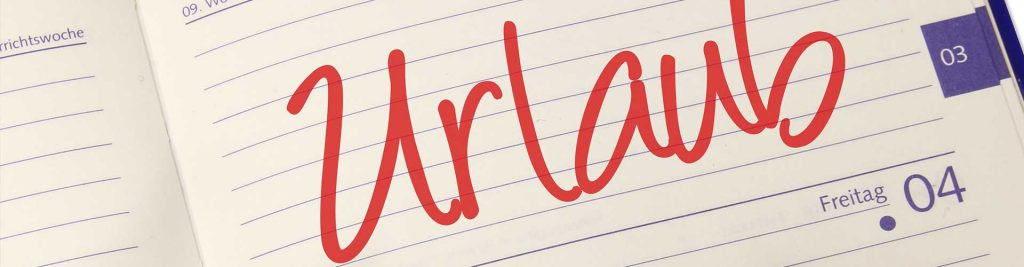- Was ist Prozesskostenhilfe?
- Prozesskostenhilfe im Arbeitsrecht
- Wann bekomme ich Prozesskostenhilfe bei einer Kündigungsschutzklage?
- Wie beantrage ich Prozesskostenhilfe richtig?
- Welche Kosten entstehen – mit und ohne Prozesskostenhilfe?
- Wann bin ich finanziell bedürftig?
- Muss ich Prozesskostenhilfe zurückzahlen?
- Wie funktioniert die Ratenzahlung bei der Prozesskostenhilfe?
- Fazit
- Häufige Fragen zur Prozesskostenhilfe
1. Was ist Prozesskostenhilfe?
Rechtsgrundlage sind die §§ 114 ff. Zivilprozessordnung (ZPO).
Wichtig zu wissen ist:
- Abgedeckt werden Gerichtskosten und – wenn beantragt je nach Einkommenslage – auch die Kosten des eigenen Rechtsanwalts.
- Der Staat übernimmt die Kosten ganz oder teilweise.
- Voraussetzung ist, dass die beabsichtigte Klage hinreichende Erfolgsaussichten hat.
- Ziel ist, den gleichen Zugang zum Rechtsschutz für alle zu sichern.
Damit stellt die Prozesskostenhilfe sicher, dass kein Arbeitnehmer auf eine Kündigungsschutzklage verzichten muss, nur weil er die Kosten nicht tragen kann.
2. Prozesskostenhilfe im Arbeitsrecht
Die Prozesskostenhilfe kann in allen arbeitsgerichtlichen Verfahren beantragt werden – also nicht nur bei einer Kündigungsschutzklage, sondern etwa auch bei Klagen auf Lohnzahlung, Zeugniserteilung, oder in Fällen von Diskriminierungen. Rechtsgrundlagen sind immer die §§ 114 ff. ZPO. Damit sind die rechtlichen Voraussetzungen in allen Verfahren gleich (siehe im Detail den nächsten Abschnitt): Das Gericht prüft, ob die Klage hinreichende Erfolgsaussichten hat, nicht mutwillig ist und der Antragssteller finanziell bedürftig ist.
Im Arbeitsrecht gelten besondere Kostenregeln, die für Arbeitnehmer oft überraschend sind. Sie unterscheiden sich in einigen Punkten von Regeln in zivilrechtlichen Verfahren.
Nach § 12a Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) gilt in der ersten Instanz:
- In der ersten Instanz trägt jede Partei ihre eigenen Anwaltskosten, unabhängig vom Ausgang des Verfahrens. Das bedeutet: Selbst, wenn der Arbeitnehmer gewinnt, muss er seinen Anwalt grundsätzlich selbst bezahlen.
- Gerichtskosten entstehen nur, wenn der Rechtsstreit nicht durch Vergleich endet.
- In der zweiten Instanz gilt diese Regel nicht mehr. Die unterlegene Partei muss dann die Kosten des Gegners übernehmen.
Diese Regel macht die Prozesskostenhilfe besonders bedeutsam. Sie kann dafür sorgen, dass auch Arbeitnehmer ohne Rechtsschutzversicherung zum Beispiel ihren Anspruch auf Weiterbeschäftigung durchsetzen können.
3. Wann bekomme ich Prozesskostenhilfe bei einer Kündigungsschutzklage?
Eine Prozesskostenhilfe wird nur gewährt, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Das Gericht prüft den Antrag genau und berücksichtigt dabei drei zentrale Punkte:
Erfolgsaussichten der Klage
- Die Kündigungsschutzklage darf nicht aussichtslos erscheinen.
- Wenn z. B. Formfehler in der Kündigung vorliegen oder kein klarer Kündigungsgrund erkennbar ist, sind die Erfolgsaussichten meist gegeben.
Finanzielle Bedürftigkeit
- Der Arbeitnehmer darf die Kosten eines Prozesses nicht ohne weiteres aus eigenem Einkommen oder Vermögen zahlen können.
- Maßgeblich sind aktuelle Einkünfte, Miete, Unterhaltspflichten und Vermögenswerte.
Keine Mutwilligkeit
- Die Klage darf nicht leichtfertig oder ohne vernünftigen Grund eingereicht werden. Beispiel: Wer eine eindeutig berechtigte Kündigung angreift, riskiert die Ablehnung des Antrags.
4. Wie beantrage ich Prozesskostenhilfe richtig?
Der Antrag auf Prozesskostenhilfe kann vor oder nach Einreichung der Kündigungsschutzklage gestellt werden. Wichtig ist jedoch, dass die Kündigungsschutzklage innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung erhoben wird, auch wenn die Bewilligung der Prozesskostenhilfe durch das Gericht noch nicht erfolgt ist. Im Antrag auf Prozesskostenhilfe müssen Arbeitnehmer ihre wirtschaftliche Situation offenlegen, damit das Gericht den Antrag bewilligen kann.
So gehen Sie vor:
- Formular ausfüllen: Verwenden Sie das offizielle Formular „Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse“. Es ist bundesweit einheitlich und z. B. über das Justizportal NRW abrufbar.
- Belege beifügen: Erforderlich sind Nachweise über Einkommen (z. B. Lohnabrechnungen), Miete, Versicherungen, Kredite und Unterhaltspflichten.
- Einreichung beim Gericht: Der Antrag wird meist vom Anwalt zusammen mit der Klage oder kurz danach bei dem Gericht eingereicht, das auch für die Kündigungsschutzklage zuständig ist.
- Prüfung durch das Gericht: Das Gericht entscheidet, ob die Voraussetzungen erfüllt sind und ob die Klage Erfolgsaussichten hat.
- Bewilligung oder Ablehnung: Bei Bewilligung übernimmt die Staatskasse die Kosten – ganz oder teilweise. Wird der Antrag abgelehnt, muss der Arbeitnehmer die Kosten selbst tragen.
5. Welche Kosten entstehen – mit und ohne Prozesskostenhilfe?
Die Kostenstruktur im Arbeitsrecht unterscheidet sich von der in anderen Zivilverfahren. Wie schon erwähnt gilt nach § 12 a Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG):
- In der ersten Instanz trägt jede Partei ihre Anwaltskosten selbst, unabhängig davon, wer den Prozess gewinnt oder verliert.
- Das betrifft nicht nur Kündigungsschutzklagen, sondern zum Beispiel auch andere Klagen, wie solche auf Lohn oder Zeugniserteilung.
Die Kosten einer Kündigungsschutzklage hängen vom Streitwert ab – in der Regel werden drei Bruttomonatsgehälter pauschal zugrunde gelegt. Davon ausgehend berechnen sich sowohl die Gerichtskosten als auch die Anwaltsgebühren.
Ohne Prozesskostenhilfe
- Der Arbeitnehmer muss Gerichts- und Anwaltskosten selbst zahlen.
- Nur wenn ein Vergleich geschlossen wird, entfallen die Gerichtskosten. Die Anwaltskosten steigen im Vergleichsfall leicht an.
Mit Prozesskostenhilfe
Die Staatskasse übernimmt die Kosten zunächst vollständig. Ob später Raten zu zahlen sind, hängt vom „einzusetzenden Einkommen“ des Arbeitnehmers ab – also dem Betrag, der nach Abzug von Miete, Unterhalt und Freibeträgen vom Einkommen übrigbleibt. Mehr dazu im Abschnitt „Wie funktioniert Ratenzahlung bei der Prozesskostenhilfe?“.
6. Wann bin ich finanziell bedürftig?
Ob ein Arbeitnehmer Prozesskostenhilfe erhält, hängt wesentlich davon ab, ob er finanziell bedürftig ist.
Das Gericht prüft dabei, wie viel Geld nach Abzug aller regelmäßigen Belastungen tatsächlich zum Leben bleibt – das sogenannte einzusetzende Einkommen.
Maßgeblich ist das monatliche Nettoeinkommen
Zum Einkommen zählen alle regelmäßigen Zahlungen, etwa:
- Arbeitslohn, Renten, Pensionen oder selbstständige Einkünfte
- Wohngeld, Kindergeld und Unterhaltsleistungen
- Einnahmen aus Vermietung oder Kapitalerträge
Abzugsfähige Ausgaben
Von diesem Einkommen dürfen regelmäßig abgezogen werden:
- Miete und Nebenkosten
- Beiträge zu notwendigen Versicherungen
- Fahrkosten zur Arbeit
- Unterhaltszahlungen
Freibeträge nach der Prozesskostenhilfebekanntmachung 2025
Zusätzlich berücksichtigt das Gericht gesetzliche Freibeträge. Diese sollen sicherstellen, dass niemand sein gesamtes Einkommen für Prozesskosten einsetzen muss:
| Personengruppe | Freibetrag pro Monat (2025) |
| Antragsteller | 619 € |
| Erwerbstätigenzuschlag | 282 € |
| Ehegatte/Lebenspartner | 496 € |
| Kind bis 6 Jahre | 393 € |
| Kind 7–14 Jahre | 429 € |
| Kind 15-18 Jahre | 518 € |
Vermögen
Bestimmte Vermögenswerte müssen grundsätzlich eingesetzt werden, bevor Prozesskostenhilfe bewilligt wird.
Davon ausgenommen sind:
- Bargeld oder Bankguthaben bis ca. 2.000 €,
- selbstbewohntes Wohneigentum,
- gesetzlich geförderte oder nachweislich zweckgebundene Altersvorsorge (z. B. Riester- und Rüruprenten, betriebliche Altersvorsorge) und
- für die Berufsausübung notwendige Gegenstände.
Wer nach dieser Berechnung nur wenig oder gar kein einzusetzendes Einkommen hat, gilt als bedürftig und kann Prozesskostenhilfe erhalten.
Konkrete Rechenbeispiele mit diesen Freibeträgen finden sich im Abschnitt „Wie funktioniert die Ratenzahlung bei der Prozesskostenhilfe?“.
7. Muss ich Prozesskostenhilfe zurückzahlen?
Ob eine Rückzahlungspflicht besteht, hängt davon ab, wie sich die finanziellen Verhältnisse nach dem Verfahren entwickeln.
Grundsätzlich gilt:
- Die Staatskasse übernimmt zunächst alle Kosten.
- Eine Rückzahlung kann jedoch später angeordnet werden – vor allem dann, wenn sich das Einkommen verbessert.
Wann eine Rückzahlung droht:
- Das Gericht prüft bis zu vier Jahre nach Abschluss des Verfahrens, ob sich das Einkommen des Antragstellers wesentlich verändert hat (§ 120a ZPO).
- Eine wesentliche Verbesserung liegt vor, wenn das Einkommen sich dauerhaft um mehr als etwa 100 € monatlich erhöht.
- Auch neu entstandenes Vermögen (z. B. durch Erbschaft, Bonuszahlung oder Abfindung) kann eine Rückzahlungspflicht auslösen.
Wie die Rückzahlung erfolgt:
- Das Gericht kann nachträglich Raten festsetzen oder bestehende Raten anpassen.
- Die Rückzahlung erfolgt stets an die Staatskasse, nicht an den Anwalt.
- Die maximal mögliche Rückzahlungsdauer beträgt 48 Monate.
Wann keine Rückzahlung verlangt wird:
- Wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse sich nicht verbessern, bleibt die Prozesskostenhilfe dauerhaft ratenfrei. Dies gilt insbesondere bei Verlust des Arbeitsplatzes oder längerer Arbeitslosigkeit.
8. Wie funktioniert die Ratenzahlung bei der Prozesskostenhilfe?
Nicht jeder, der Prozesskostenhilfe erhält, muss gar nichts zahlen. Abhängig vom Einkommen kann das Gericht Ratenzahlungen anordnen. Das bedeutet: Die Staatskasse übernimmt zunächst alle Kosten, der Arbeitnehmer zahlt aber später einen Teil davon in monatlichen Raten zurück.
Die Ratenhöhe richtet sich nach dem sogenannten einzusetzenden Einkommen –
also dem Betrag, der nach Abzug der Miete, weiterer laufender Kosten und der gesetzlichen Freibeträge übrigbleibt. Nach § 115 Abs. 2 ZPO ist in der Regel die Hälfte des einzusetzenden Einkommens als monatliche Rate festzusetzen.
Die Zahlung erfolgt maximal über 48 Monate; danach gelten die Kosten als getilgt, selbst wenn noch ein Restbetrag offenbleibt.
Die folgenden Beispiele beruhen auf den Freibeträgen der Prozesskostenhilfebekanntmachung (PKHB) 2025:
Beispiel 1: Ratenfreie Prozesskostenhilfe
Arbeitnehmerin A verdient 1.750 € netto, zahlt 650 € Miete und hat zwei Kinder (5 und 12 Jahre).
Freibeträge nach PKHB 2025:
- 619 € (A selbst)
- 282 € (Erwerbstätigenzuschlag)
- 393 € (Kind unter 6 Jahren)
- 429 € (Kind 7–14 Jahre)
Berechnung:
- Einkommen: 1.750 €
- Abzug Miete: -650 €
- Abzug Freibeträge: –1.723 €
Einzusetzendes Einkommen: –623 €
Da kein einzusetzendes Einkommen verbleibt, bewilligt das Gericht ratenfreie Prozesskostenhilfe. A muss nichts zahlen, sämtliche Kosten trägt die Staatskasse.
Beispiel 2: Prozesskostenhilfe mit Ratenzahlung
Arbeitnehmer B verdient 2.400 € netto, zahlt 900 € Miete und hat keine Unterhaltspflichten.
Freibeträge nach PKHB 2025:
- 619 € (B selbst)
- 282 € (Erwerbstätigenzuschlag)
Berechnung:
- Einkommen: 2.400 €
- Abzug Miete: –900 €
- Abzug Freibeträge: –901 €
Einzusetzendes Einkommen: 599 €
Nach § 115 ZPO ist die Hälfte dieses Betrags als monatliche Rate zu leisten. Das Gericht bewilligt PKH mit monatlichen Raten von 300 € (gerundet). Die Zahlungen erfolgen maximal über 48 Monate. Danach gelten die Prozesskosten als vollständig beglichen.
9. Fazit
- Prozesskostenhilfe ermöglicht Arbeitnehmern den Zugang zum Arbeitsgericht, auch wenn eigenes Einkommen und Vermögen gering sind.
- Besonders häufig wird Prozesskostenhilfe bei der Kündigungsschutzklage für Arbeitnehmer relevant. Dies gilt vor allem, da in der ersten Instanz keine Kostenerstattung erfolgt.
- Voraussetzung für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe sind hinreichende Erfolgsaussichten der Klage, keine Mutwilligkeit und finanzielle Bedürftigkeit.
- Das Gericht prüft Einkommen, Ausgaben und Vermögen und zieht dafür insbesondere die Freibeträge der jeweils gültigen Prozesskostenhilfebekanntmachung heran.
- Bei geringem Einkommen und Vermögen wird ratenfreie Prozesskostenhilfe gewährt. Das Geld muss nur zurückgezahlt werden, wenn sich die wirtschaftliche Lage des Arbeitnehmers innerhalb von vier Jahren wesentlich verbessert.
- Bei leicht höherem Einkommen und Vermögen muss die Prozesskostenhilfe in der Regel in Raten über bis zu 48 Monate zurückgezahlt werden.
- Bestimmte Vermögenswerte – etwa gesetzlich geförderte Altersvorsorge oder selbstbewohntes Wohneigentum – sind geschützt und müssen nicht angetastet werden, um Prozesskosten selbst zu finanzieren.