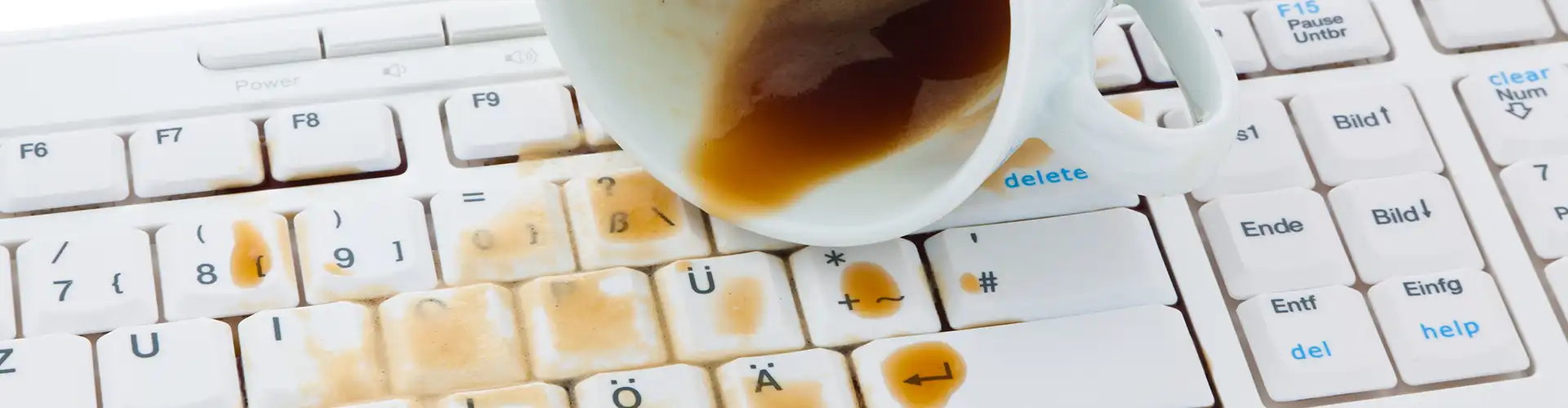1. Wann haften Arbeitnehmer am Arbeitsplatz?
Grundsätzlich gilt: Arbeitnehmer müssen die ihnen übertragenen Aufgaben sorgfältig und gewissenhaft auszuführen. Dennoch kann es im Arbeitsalltag natürlich zu Schäden kommen – etwa durch einen Unfall mit dem Firmenwagen, einen Bedienungsfehler an der Maschine oder das Verschütten von Kaffee über den Dienst-Laptop.
Im Unterschied zum allgemeinen Zivilrecht ist die Haftung von Arbeitnehmern im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses jedoch deutlich eingeschränkt, weil Arbeitnehmer auf Weisung des Arbeitgebers tätig werden und oft unter Zeitdruck oder in Stresssituationen arbeiten. Das Risiko von Fehlern ist daher erhöht. Aus diesem Grund schützt die Rechtsprechung Arbeitnehmer vor einer übermäßigen Haftung.
Maßgeblich für die Einordnung eines Vorfalls sind insbesondere folgende Kriterien:
- Schadenshöhe: Die finanzielle Dimension des entstandenen Schadens spielt eine zentrale Rolle. Je höher der Schaden, desto sorgfältiger erfolgt die Prüfung der Haftungsverteilung.
- Art und Schwere des Verschuldens: Es wird unterschieden, ob dem Arbeitnehmer leichte, mittlere oder grobe Fahrlässigkeit bzw. Vorsatz zur Last gelegt werden kann. Die Einordnung erfolgt anhand objektiver Maßstäbe, z. B. ob ein alltägliches Versehen oder eine gravierende Pflichtverletzung vorliegt.
- Stellung und Ausbildung des Arbeitnehmers: Hierbei wird berücksichtigt, welche Funktion, Verantwortung und Qualifikation der Arbeitnehmer im Betrieb hat. Von einer Führungskraft oder speziell ausgebildeten Fachkraft wird ein höheres Maß an Sorgfalt erwartet als von einem ungelernten Mitarbeiter.
- Gefährdungspotenzial der Tätigkeit: Tätigkeiten, die ein höheres Risiko für Schäden bergen (z. B. Umgang mit Maschinen, Fahrzeugen oder wertvollen Gütern), erfordern ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Dies fließt in die Bewertung der Haftung ein.
Die konkrete Haftungsverteilung erfolgt unter Abwägung aller genannten Kriterien im Einzelfall. Dabei werden sowohl die individuellen Umstände des Schadensfalls als auch die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen des Arbeitnehmers berücksichtigt.
2. Personen- vs. Sachschäden
Im Arbeitsverhältnis können verschiedene Arten von Schäden entstehen. Für die Haftung ist es wichtig, diese zu unterscheiden:
Sachschäden
Hier gelten die Grundsätze des sogenannten „innerbetrieblichen Schadenausgleichs“: Die Haftung des Arbeitnehmers ist eingeschränkt und richtet sich danach, wie schwer der Fehler war (leichte, mittlere oder grobe Fahrlässigkeit bzw. Vorsatz).
Personenschäden
Bei Personenschäden im Betrieb – also bei Arbeitsunfällen – greifen die besonderen Regelungen der gesetzlichen Unfallversicherung (§§ 104 ff. SGB VII). Diese Versicherung übernimmt in den meisten Fällen die Haftung sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer.
Das heißt: Wenn ein Arbeitnehmer im Betrieb fahrlässig einen Kollegen verletzt, müssen weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer persönlich haften – die Unfallversicherung springt ein.
3. Schäden an Firmeneigentum vs. Schäden gegenüber Dritten
Die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur beschränkten Arbeitnehmerhaftung finden ausschließlich im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Anwendung.
Gegenüber Dritten haften Arbeitnehmer hingegen nach den allgemeinen zivilrechtlichen Grundätzen, ohne besondere Haftungserleichterungen. Schäden an Dritten, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit Kunden oder Lieferanten, werden in der Regel durch die Betriebshaftpflichtversicherung des Arbeitgebers abgedeckt. Ein Regress des Arbeitgebers gegen den Arbeitnehmer ist grundsätzlich nur bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten möglich.
4. Wie wird der Grad des Verschuldens bestimmt?
Die sogenannte „beschränkte Arbeitnehmerhaftung“ ist ein besonderer Schutzmechanismus im Arbeitsrecht und sorgt dafür, dass Arbeitnehmer bei betrieblich veranlassten Tätigkeiten nicht mit ihrem gesamten Privatvermögen für Schäden haften müssen.
Voraussetzungen der Haftungsbeschränkung einer Arbeitnehmerhaftung sind:
- Bestehen eines Arbeitsverhältnisses
- Betrieblich veranlasste Tätigkeit
- Art und Schwere des Verschuldens (in der Regel Beschränkung bis maximal mittlere Fahrlässigkeit)
Ob und in welchem Umfang ein Arbeitnehmer für einen Schaden haftet, bestimmt sich nach den folgenden von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zum Verschuldensgrad:
Leichte Fahrlässigkeit
Ein alltägliches Versehen, das jedem passieren kann.
Beispiel: Ein Glas Wasser wird versehentlich umgestoßen.
Folge für Arbeitnehmer: In der Regel keine Haftung.
Mittlere Fahrlässigkeit
Der Arbeitnehmer hätte den Schaden durch mehr Sorgfalt vermeiden können.
Mittlere Fahrlässigkeit liegt vor, wenn die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen wurde und der Schaden bei gebotener Sorgfalt vorhersehbar und vermeidbar gewesen wäre (§ 276 Abs. 2 BGB).
Beispiele:
- Missachtung von Arbeitsanweisungen oder mangelnde Aufmerksamkeit.
- Ein Arbeitnehmer fährt mit dem Dienstwagen auf dem Dienstgelände anstatt den erlaubten 10 km/h bei schlechten Wetterbedingungen 30 km/h und es entsteht dabei ein Schaden.
- Ein Arbeitnehmer vergisst – trotz konkreter Arbeitseinweisung – eine Maschine nach Gebrauch auszuschalten, was zu einem Defekt führt.
Folge für Arbeitnehmer: Schaden wird anteilig zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgeteilt (z. B. 40 % Arbeitnehmer, 60 % Arbeitgeber).
Grobe Fahrlässigkeit
Sorgfaltspflichten werden in besonders schwerem Maße verletzt.
Grob fahrlässig handelt, wer die erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße verletzt und unbeachtet lässt, was jedem hätte einleuchten müssen.
Beispiele:
- Missachtung klarer Sicherheitsvorschriften
- Fahren unter Alkoholeinfluss
- Fahren ohne Fahrerlaubnis (außer vom Arbeitgeber angeordnet)
- Erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung
- Unfall unter erheblicher Alkoholeinwirkung
- Überfahren einer roten Ampel
Folge für Arbeitnehmer: Arbeitnehmer haftet grundsätzlich voll.
Vorsatz
Der Arbeitnehmer handelt absichtlich oder bewusst pflichtwidrig. Volle Schadenersatzpflicht besteht allerdings nur, wenn der Arbeitnehmer seine Sorgfaltsflicht absichtlich verletzt hat und der Schaden genau durch diese Absicht verursacht wurde (BAG, Urt. v. 18.4.2002 – 8 AZR 348/01).
Beispiel: Bewusste Missachtung einer klaren Arbeitsanweisung oder absichtliche Zerstörung von Arbeitsmitteln, Maschinen oder Fahrzeugen, um dem Arbeitgeber zu schaden.
Folge für Arbeitnehmer: Volle Haftung.
5. Fazit
- Arbeitnehmer haften für Schäden am Arbeitsplatz nur eingeschränkt – je nach Grad des Verschuldens:
- Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Arbeitnehmer in der Regel gar nicht („Das passiert jedem Mal“)
- bei mittlerer Fahrlässigkeit anteilig („Das darf eigentlich nicht passieren, kann aber ausnahmsweise mal vorkommen“)
- bei grober Fahrlässigkeit („Das darf wirklich nicht passieren“) oder Vorsatz grundsätzlich voll.
- Die Haftung kann im Einzelfall durch ein Gericht gemildert werden, insbesondere um existenzbedrohende Belastungen zu vermeiden.
- Schäden gegenüber Dritten (z.B. Kunden, Lieferanten oder Passanten) sind meist über den Arbeitgeber versichert. Ein Regress gegen den Arbeitnehmer ist die Ausnahme. Allerdings greift die eingeschränkte Haftung am Arbeitsplatz in diesen Fällen nicht.